Die Astrologisch – Soziomorphe Welterklärung – Dr. Susanne Denningmann – Die astrologische Lehre der Doryphorie – Eine soziomorphe Metapher in der antiken Planetenastrologie
Dr. Susanne Denningmann – Die astrologische Lehre der Doryphorie: Eine soziomorphe Metapher in der antiken Planetenastrologie
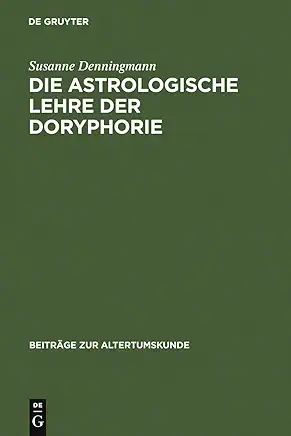
Die astrologische Lehre der Doryphorie (δορυφορία, wörtlich „Speerträger“) gehört zu den ältesten und zugleich symbolisch tiefsten Konzepten der hellenistischen Astrologie. Sie beruht auf der Vorstellung, dass ein Planet – meist die Sonne oder der Mond, also die Lichter – von anderen Planeten begleitet oder „beschützt“ wird, die wie Leibwächter um ihn stehen. Diese Bildsprache ist nicht bloß ornamentale Mythologie, sondern Ausdruck eines soziomorphen Weltverständnisses, in dem der Kosmos nach den Mustern menschlicher Gesellschaft geordnet ist.
Im antiken Griechenland, insbesondere in der höfischen Welt der Monarchie und der Polis, war der Begriff des Doryphoros unmittelbar sozial codiert: Ein Herrscher oder Feldherr wurde von seinen Speerträgern umgeben, die seine Autorität schützten und gleichzeitig ihre eigene Stellung aus seiner Macht ableiteten. Diese politische und militärische Struktur diente der Astrologie als Modell für das Verhältnis zwischen den Planeten: Die Sonne oder der Mond verkörpern die zentrale Autorität – das Königtum des Horoskops –, während die Begleiterplaneten, die in bestimmter Stellung zu ihnen stehen, als Gefolgschaft, Minister oder Schutzkräfte fungieren.
Die Doryphorie lehnt sich somit an ein hierarchisches, höfisches Gesellschaftsbild an. Die Planetenordnung wird anthropomorph und soziomorph zugleich verstanden: Wie im Hofstaat jeder Akteur eine definierte Rolle und Würde hat, so besitzt auch im Kosmos jeder Planet eine soziale Funktion im Dienst des „Königs“. Die astrologische Deutung beschreibt daher nicht bloß physische Nähe, sondern symbolische Loyalität und Autorität.
In der Lehre nach Ptolemaios, Dorotheos und Hephaistio gilt ein Planet als Speerträger, wenn er sich in bestimmten Winkeln vor oder hinter den Lichtern befindet und dabei in Aspekten oder Würden steht, die Schutz verleihen. Eine Sonne, die von würdigen Planeten begleitet wird, weist auf eine starke, geehrte und souveräne Persönlichkeit hin. Fehlen solche Begleiter, so wird die Person isoliert, verwundbar oder ohne Unterstützung beschrieben – wie ein König ohne Hofstaat.
Diese Bildstruktur spiegelt den Grundgedanken der antiken soziomorphen Kosmologie: Der Himmel ist wie die Polis, die göttliche Ordnung gleicht der gesellschaftlichen. Die Bewegungen der Planeten werden als soziale Interaktion verstanden – als Rat, Bündnis, Gefolgschaft oder Verrat. Die Doryphorie illustriert somit, wie Astrologie ursprünglich nicht naturwissenschaftlich, sondern gesellschaftlich-mythologisch dachte: Die Sterne agieren wie Menschen, und die Gesellschaft der Menschen bildet die himmlische Ordnung ab.
Man kann daher sagen, dass die Doryphorie eine metaphorische Soziologie des Himmels ist. Sie zeigt, wie tief das antike Weltbild durch analoge Übertragungen geprägt war: Der Kosmos war nicht bloß ein mechanisches System, sondern ein lebendiger Staat aus göttlichen Personen. Diese Denkfigur ist typisch für die soziomorphe Welterklärung, in der das Soziale das Paradigma des Kosmischen bildet – der Mensch deutet den Himmel nach den Mustern seiner eigenen Ordnung.
In der Astrologie und in der Geschichte des abendländischen Weltbildes ist die soziomorphe Welterklärung geradezu grundlegend. Sie bildet den geistigen Hintergrund, aus dem die Idee einer kosmischen Ordnung überhaupt entsteht.
Das astrologische Weltbild der Antike, der Renaissance und auch der traditionellen Lehre bis in die Neuzeit hinein versteht das Universum nicht als bloß mechanischen Raum, sondern als ein geordnetes Gemeinwesen, ein „Kosmos“ im eigentlichen Sinn – also eine hierarchisch gegliederte, sinnhaft verbundene Ganzheit. Dieses Denken überträgt die Struktur der menschlichen Gesellschaft – Rang, Herrschaft, Dienst, Verantwortung, Lohn, Sünde, Gnade – auf den Himmel.
Die Planeten erscheinen darin wie Amtsträger oder Beamte der göttlichen Ordnung. Jeder hat seine Zuständigkeit, seine Würde, seinen Rang und seine Sphäre. Der „oberste Herrscher“ (Jupiter oder auch die Sonne, je nach System) steht an der Spitze; unter ihm wirken die anderen Kräfte wie Minister, Richter oder Boten. Auch das Haus-System der Horoskopdeutung spiegelt diese soziomorphe Sicht: das 10. Haus etwa ist der Ort der Autorität, des Königtums, der öffentlichen Rolle – analog zum Rang im irdischen Gefüge.
Der Mensch wiederum gilt als Mikrokosmos, das heißt, seine Seele ist ein Abbild der großen himmlischen Gesellschaft. Das „wie oben, so unten“ (Tabula Smaragdina) beschreibt genau diese soziomorphe Korrespondenz: Der Kosmos ist eine Art überirdischer Staat, der Mensch sein irdischer Zweig.
Diese Vorstellung durchzieht auch die christlich geprägte Kosmologie: Gott als Herrscher, Engel als himmlische Hierarchien, Naturkräfte als Werkzeuge göttlicher Ordnung. Thomas von Aquin spricht vom „ordo universi“, einer göttlich gewollten sozialen Struktur, die sich in allem wiederfindet.
Erst mit dem Aufkommen des mechanistischen Weltbildes im 17. Jahrhundert (Galilei, Descartes, Newton) wurde diese soziomorphe Sicht verdrängt und durch eine technomorphe Welterklärung ersetzt: Der Kosmos als Maschine, Gott als Uhrmacher.
In der Astrologie aber bleibt das soziomorphe Prinzip erhalten. Sie liest den Himmel weiterhin als symbolische Ordnung von „Personen“ und Beziehungen, nicht als anonyme Kräfte. Die Planeten „wirken“, „antworten“, „richten“ oder „segnen“ – Begriffe, die ursprünglich aus dem sozialen Bereich stammen.
Die soziomorphe Welterklärung durchzieht die Geschichte der Astrologie und prägte über Jahrtausende das abendländische Weltbild. Im Folgenden werden die zentralen Aspekte, Autoren und historischen Bezüge in zusammenhängenden Abschnitten erläutert.
Ursprünge und Grundstruktur
Bereits in Mesopotamien und Babylonien wurden die Bewegungen der Himmelskörper nicht nur beobachtet, sondern man verstand die Planeten und Sterne als Botschafter göttlicher Ordnung. Diese Himmelskörper besaßen bestimmte Zuständigkeiten und wurden analog zu gesellschaftlichen Amtsträgern gesehen. Die Astrologie entwickelte eine kosmische Hierarchie, in der Planeten wie Minister, Richter oder Boten eines übergeordneten Herrschers handelten. Dieses Denken, das menschliche Gesellschaftsstrukturen auf den Kosmos übertrug, lag der Astrologie der Antike, des Mittelalters und der Renaissance zugrunde und prägte das Weltbild bis tief in die Neuzeit hinein.
Die Entsprechungslehre: Makrokosmos und Mikrokosmos
Ein zentrales Motiv ist schon im Hellenismus wie auch später in der christlichen Kosmologie das Prinzip „wie oben, so unten“. Der Mensch gilt als Mikrokosmos, also als Abbild des großen himmlischen Gemeinwesens. Die verschiedenen Funktionsbereiche der Gesellschaft – Rang, Dienst und Verantwortung – wurden als Spiegelung einer kosmischen Ordnung verstanden. Die Planeten handeln als symbolische Figuren in einem übergeordneten, heiligen Staat und ordnen damit Gleichnisse sozialer Beziehungen auf den Himmel zurück. Das astrologische Häuser-System reflektiert diese Sichtweise, indem etwa das zehnte Haus mit Autorität, königlicher oder gesellschaftlicher Würde assoziiert wird.
Christliche Kosmologie und Scholastik
Im Mittelalter wurde dieses kosmisch-soziomorphe Weltbild durch christliche Denker wie Thomas von Aquin vertieft. Mit dem Begriff „ordo universi“ beschrieb Aquin eine göttlich gewollte soziale Struktur, die sich in allem widerspiegelt – von den Engeln als himmlischen Hierarchien bis hin zu den Naturkräften als Werkzeuge der göttlichen Ordnung. Der Kosmos erschien als eine göttliche, durchgängig hierarchisierte Gesellschaft, deren irdisches Abbild die menschliche Gemeinschaft ist.
Die Umbruchszeit des 17. Jahrhunderts
Ein grundlegender Wandel setzte im 17. Jahrhundert mit dem Aufkommen des mechanistischen Weltbildes ein. Galilei, Descartes und Newton beschrieben den Kosmos als riesige Maschine, in der Gott als Uhrmacher fungierte. Dieses Modell verdrängte nach und nach die Vorstellung kosmischer Amtsträger und ersetzte die strukturierte Symbolik durch ein naturwissenschaftlich-technisches Verständnis der Welt. Dennoch blieb die soziomorphe Deutung in der Astrologie erhalten, während sich die übrigen Wissenschaften von ihr abkehrten.
Moderne Interpretationen und Systemansätze
Auch im 20. Jahrhundert wurde die soziomorphe Struktur des astrologischen Denkens von Autoren wie Michael Roscher betont. Er entwickelte systemische Modelle, in denen Planeten als Regulatoren sozialer Prozesse wirken und ordnete sie bestimmten sozialen Ebenen zu. Dabei knüpfte er direkt an die klassische Tradition der Entsprechung von sozialer und kosmischer Ordnung an. Die moderne astrologische Psychologie, etwa bei C.G. Jung, interpretiert die archetypische Qualität der Planeten ebenfalls als eine Spiegelung kollektiver psychischer und gesellschaftlicher Muster.
Kontinuität bis in die Gegenwart
Die soziomorphe Sicht des Kosmos als einer großen, sinnhaft gegliederten Gemeinschaft bildet in vielen astrologischen Schulen weiterhin das geistige Fundament. Sie erhält die Sprache und Bildwelt von Rängen, Beziehungen und Aufgaben der Planeten als lebendiges Deutungsmuster, das weit über mechanistische oder rein naturwissenschaftliche Ansätze hinausgeht.

